Münster (ukm/kw) – Kalt, dunkel und regnerisch: Die Wettervorhersagen waren wochenlang kaum verändert. Das wirkt sich auf die Stimmungslage von vielen Menschen aus – sie haben schlechte Laune und sind antrieblos. Aber handelt es sich dabei schon um eine Winterdepression? Im Interview grenzt Prof. Udo Dannlowski, Leiter der Sektion für Transitionspsychiatrie in der Klinik für Psychische Gesundheit am UKM, die Winterdepression vom Winterblues ab und verrät, ab wann sich Betroffene professionelle Hilfe suchen sollten.
Herr Prof. Dannlowski, im Winter berichten viele von einer erhöhten Müdigkeit und einer gedrückten Stimmung. Handelt es sich bei solchen Empfindungen bereits um eine Winterdepression?
Fast alle kennen das: Es ist kalt und dunkel draußen und dadurch bekommen wir schlechte Laune, fühlen und energielos und werden häufiger krank. Diese depressiven Symptome treten im Winter bei vielen Menschen gehäuft auf. Erst wenn die Verstimmungen klinisch relevant werden, bezeichnen Expertinnen und Experten sie als Winterdepression.
Können Sie beschreiben, was eine Winterdepression im klinischen Sinne ist?
Die Winterdepression gehört allgemein zu den affektiven, depressiven Störungen mit saisonalen Mustern. Der Begriff ist missverständlich, denn nicht jede Depression, die im Winter auftritt, ist eine Winterdepression. Auch die „normale“ wiederkehrende depressive Störung hat Episoden, die sich im Winter zeigen können. Generell ähnelt die Winterdepression anderen Depressionen sehr, weshalb die Abgrenzung im klinischen Sinne kaum eine Rolle spielt. Dennoch gibt es einige atypische Symptome, die die Winterdepression von anderen Formen der Depression unterscheiden. Beispielsweise haben Erkrankte meist mehr – und nicht wie bei anderen depressiven Störungen – weniger Appetit. Außerdem äußert sich ihre Müdigkeit in vermehrtem Schlaf und nicht in Schlafstörungen wie bei chronischen Depressionen.
Welche Gegebenheiten begünstigen eine Winterdepression?
Es gibt vielfältige Gründe, wieso Menschen eine Depression entwickeln. Umweltbedingungen können eine externe Ursache für Depressionen sein. Besonders der geringe Lichteinfall im Herbst und Winter hat Einfluss auf Patientinnen und Patienten mit saisonalen depressiven Mustern. Im Winter ist es oft dunkel und daher fällt weniger Licht auf die Netzhaut. Dadurch verändert sich die körpereigene Produktion von Melatonin, was Auswirkungen auf Immunsystem, den Kortisolspiegel und andere körpereigene Abläufe hat, die depressive Verstimmungen hemmen oder fördern können. Noch dazu gehen Menschen wegen des kalten und oft ungemütlichen Wetters seltener an die frische Luft, um sich dort zu bewegen. Ausreichend Bewegung gehört aber zu den Aktivitäten, die Menschen körperlich und seelisch stärken – gerade im Winter.
Neben Umwelteinflüssen – gibt es auch genetische oder psychologische Ursachen für Winterdepressionen?
Menschen, deren Körper genetisch bedingt mehr oder weniger Melantonin produziert, sind anfälliger für eine Winterdepression. Außerdem können auch familiärer oder persönlicher Stress sowie Schwierigkeiten in der Partnerschaft oder im Beruf eine depressive Episode auslösen. Traumata aus der Kindheit und Jugend kommen oft auch über Weihnachten hoch und wirken länger nach, weshalb einige Menschen diese Zeit als sehr emotional belastend und stressig empfinden.
Gibt es Möglichkeiten, wie sich Menschen davor schützen können, an einer Winterdepression zu erkranken?
Die Prävention ist immer besser als die Behandlung. Wenn Menschen wissen, dass sie in der dunklen Jahreszeit oft schlecht gelaunt und demotiviert sind, sollten sie auf einen guten Tag-Nacht-Rhythmus achten. Ich empfehle auch, viel Zeit im Freien zu verbringen. Die Mittagspause kann super für einen ausgiebigen Spaziergang genutzt werden – sogar wenn die Sonne nicht scheint und es bewölkt ist. Viele Menschen wissen nicht, dass der Lichteinfall selbst bei bewölktem Himmel höher als bei Kunstlicht ist. Es gibt viele Patientinnen und Patienten, die auf Tageslichtlampen schwören. Die wirken bei einer Winterdepression nachweislich prophylaktisch, sind in vielen Fachmärkten erhältlich und werden von einigen Krankenkassen bezuschusst.
Wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem sich Betroffene nicht mehr selbst helfen können und sich professionelle Hilfe suchen sollten?
Wenn Betroffene über mindestens zwei Wochen andauernd unter schweren Symptomen leiden und lebensverneinende Gedanken oder sogar Suizidgedanken dazu kommen, dann sollten sie sich schnellstmöglich an ihren Hausarzt oder eine Klinik wenden. Zu den schweren Symptomen gehören beispielsweise eine dauerhaft stark gedrückte Stimmung, schwere Antriebslosigkeit, Schwierigkeiten den Alltag zu bewältigen oder der Verlust an Freude bei Aktivitäten, die ihnen sonst Spaß gemacht haben.



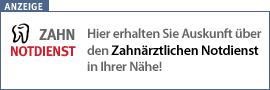





 Der Notfalldienst ist über die kostenfreie Rufnummer:
Der Notfalldienst ist über die kostenfreie Rufnummer:
