HIV – „Wir sind nah dran an den Wunden unserer Zeit“
Münster (ukm/aw) – Dr. Hannah Linke leitet seit März dieses Jahres als Oberärztin die Ambulanz für erworbene Immunschwäche in der Medizinischen Klinik D am UKM (Universitätsklinikum Münster). Sie folgte nach über 30 Jahren auf Dr. Doris Reichelt, die in den Ruhestand ging. Die Ambulanz behandelt insgesamt rund 700 Menschen aus Münster und der weiteren Region, die mit dem HI-Virus (HIV) infiziert sind, ebenso wie Menschen, die unter der vollen Ausprägung der Immunschwäche AIDS leiden.
Frau Dr. Linke, nicht nur am Welt-AIDS-Tag, sondern jeden Tag widmen Sie sich der Behandlung und Begleitung HIV-infizierter Menschen. Was ist ihre Motivation?
Ich glaube, meine Stärke liegt in der Kommunikation mit Menschen und das kann man speziell für unsere Patientinnen und Patienten gut gebrauchen. Ich bin in Botswana geboren, als mein Vater dort als Arzt gearbeitet hat. Auch wenn ich dort nicht aufgewachsen bin, hat mich das Wissen um diesen Hintergrund geprägt. Später habe ich mein Praktisches Jahr in Botswana in der Kinderheilkunde gemacht und bin dort zum ersten Mal mit HIV in Berührung gekommen. Als ich 2015 das Stellenangebot zunächst als Assistenzärztin hier in der Ambulanz bekam, musste ich erst einmal eine Nacht darüber schlafen. Dann hat es sich aber immer stimmiger angefühlt und ich kann sagen, der Kreis hat sich ein Stück weit für mich geschlossen. Zu uns kommen Menschen aus der ganzen Welt – man bekommt hier viel mit.
Seit diesem Frühjahr sehen sie vermehrt Geflüchtete aus der Ukraine in der Ambulanz?
Alle HIV-Ambulanzen in Deutschland gehen seit dem Frühjahr damit um, dass sich vermehrt Frauen und Männer aus der Ukraine, die hierher fliehen mussten, an sie wenden. Der Anstieg der Patient*innenzahlen liegt einfach darin begründet, dass die Ukraine in Europa die zweithöchste Prävalenz (Häufigkeit) an HIV-Infektionen aufweist. Träger des Virus wurden, wenn die Infektion bei ihnen bekannt war, schon in der Ukraine adäquat behandelt und wir können das hier gut fortführen. Aber alle Geflüchteten bringen ihre individuelle Geschichte mit. Sie sind zum Teil durch Kriegsgeschehen und Flucht traumatisiert. Hinzu kommt, dass sie nun Angst vor den Folgen haben, wenn ihre Infektion hier bekannt wird. Ich hatte eine schwangere Geflüchtete, die sich zwei Monate nicht getraut hat, der Familie, bei der sie untergebracht war und mit der sie gut auskam, zu sagen, dass sie einen Termin in einer HIV-Ambulanz braucht. Zum Glück hat diese Familie aber ganz fürsorglich reagiert und sich sehr gekümmert. Andere Infizierte erfahren erst hier vor Ort, dass sie HIV-positiv sind. Geflüchtet, in einem fremden Land und dann diese Diagnose – das ist eine große Herausforderung.
Eine Herausforderung in diesem Jahr waren auch die weltweit auftretenden Fälle von Affenpocken gegen die sich nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts vor allem homosexuelle Männer impfen lassen sollen?
Die Impfempfehlung des RKI betraf Männer, die Sex mit Männern haben (MSM). Aus medizinischer Sicht ist diese Zielgruppe richtig definiert, denn die meisten Patienten stammten aus dieser Risikogruppe. Trotzdem fühlten sich viele Betroffene an die Stigmatisierung von homosexuellen Männern in den Anfängen der AIDS-Epidemie in den 80er Jahren erinnert. Vor allem bei unseren älteren Patienten, die das Aufkommen des HI-Virus miterlebt haben, sind dieselben Ängste und Gefühle von Stigmatisierung wieder hochgekommen. Die saßen hier teilweise und sagten: „Jetzt sind es wieder wir“. Das kann ich nachvollziehen: Da kommt ein wenig bekanntes Virus und wieder betrifft es speziell Menschen, die sich gesellschaftlich teilweise immer noch diskriminiert fühlen, allein aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Das HI-Virus betrifft ganz häufig gesellschaftlich vulnerable Gruppen. Wir spüren die Gesamtheit der Krisen viel unmittelbarer, weil unsere Klientel größtenteils direkt davon betroffen ist. Und deshalb ist die HIV-Medizin auch immer so nah dran an den Wunden unserer Zeit.
Inzwischen sind HIV und AIDS fast in Vergessenheit geraten, andere Themen bestimmen unsere Zeit. Was würden sie sich für die gesellschaftliche Diskussion rund um HIV und seine Betroffenen wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen mehr auf dem Schirm haben, dass ein Leben mit HIV ein langes und – da wo es behandelt wird – gutes Leben sein kann. Die Infektion mit dem HI-Virus ist durch die antiretrovirale Therapie (ART) in der Mehrzahl der Fälle im Griff zu behalten. Wenn das Virus im Blut nicht nachweisbar ist, dann ist jemand auch nicht ansteckend. Unter ART kann ein infizierter, mit einem nicht-infizierten Partner sogar ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, ohne dass ein Infektionsrisiko besteht. Die Lebenserwartung von Infizierten, die frühzeitig behandelt werden, unterscheidet sich kaum von denen gesunder Personen. Auch die Möglichkeiten der Ansteckungsprävention sollte mehr besprochen werden. Bislang wissen hauptsächlich die Risikogruppen, dass es eine vorbeugende Therapie gegen eine potenzielle Übertragung des Virus gibt. Und zum Schluss wünsche ich mir, dass eine HIV-Infektion auch von den ärztlichen Kolleg*innen immer als Möglichkeit bei der Ursachen suche bestimmter Krankheitssymptome in Erwägung gezogen wird. Denn je früher eine Blutuntersuchung das Virus nachweist, desto besser behandelbar sind die Betroffenen.



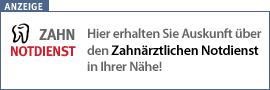





 Der Notfalldienst ist über die kostenfreie Rufnummer:
Der Notfalldienst ist über die kostenfreie Rufnummer:
