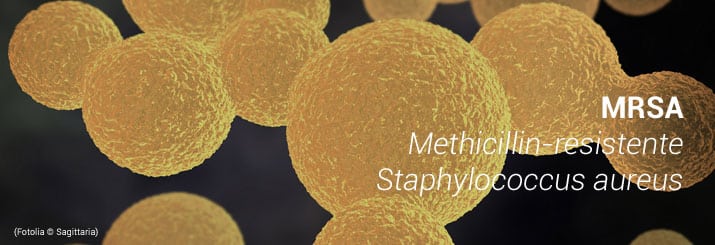
Neuer Weg im Kampf gegen MRSA: Forscher machen ein gefährliches Bakterientoxin unwirksam
Greifswald/Münster (ug) – Mit der zunehmenden Antibiotika-Resistenz werden alternative Verfahren zur Behandlung bakterieller Infektionen immer notwendiger. Forschern der Universität Greifswald ist es in Zusammenarbeit mit Kollegen der Universität Münster gelungen, Zielzellen pathogener Bakterien enzymatisch so vorzubehandeln, dass eine bedeutende toxische Wirkung des Bakteriums Staphylococcus aureus ausblieb. Die Ergebnisse wurden jetzt in der Fachzeitschrift „Toxins“ veröffentlicht.
Jeder dritte Mensch weltweit trägt das Bakterium Staphylococcus aureus ständig auf der Haut und im vorderen Nasenraum mit sich herum ohne davon etwas zu bemerken. Die Bakterien nutzen allerdings Abwehrschwächen, beispielsweise durch Alter, Bettlägerigkeit oder Virusinfekt, um sich schneller zu vermehren. Dadurch können sie pathogen werden und neben oberflächlichen Furunkeln oder Abszessen auch Infektionen im Körperinneren wie Herzinnenhautentzündung und Lungenentzündung verursachen. Überschreiten die Bakterien lokal im Körper eines Wirtes (Mensch oder Tier) eine kritische Bakteriendichte, beginnen sie mit der Produktion löslicher Toxine, die im Wirtsgewebe physiologische Veränderungen oder sogar den Zelltod auslösen können.
Eines der bedeutenden Toxine von S. aureus ist das sogenannte alpha-Toxin. Es kann Blutzellen zerstören und wird daher auch Hämolysin A genannt. Das alpha-Toxin trägt erheblich zur Pathogenität des Bakteriums bei, so dass es als einer der wichtigsten Virulenzfaktoren von S. aureus gilt. Der Wirkmechanismus des alpha-Toxins beruht auf der Bildung von Transmembranporen in den Oberflächen der Wirtszellen, den sogenannten Zellmembranen. Die dadurch entstehende offene Verbindung zwischen Extra- und Intrazellularraum erlaubt es Ionen und kleinen organischen Molekülen, Konzentrationsgefällen zu folgen und unkontrolliert in die Zelle einzuströmen oder aus der Zelle auszutreten. Damit verbunden sind erhebliche zellphysiologische Probleme. Zum Beispiel können epitheliale Zellen ihre Barrierefunktion zwischen Umwelt und Körperinnerem nicht mehr voll ausüben.
Wissenschaftler der Universität Greifswald um Dr. Sabine Ziesemer und Prof. Jan-Peter Hildebrandt in Kooperation mit einem Kollegen der HNO-Klinik am Universitätsklinikum Münster, PD Dr. Achim G. Beule, suchen daher nach Wegen, die Wirkung des alpha-Toxins auf Zielzellen zu unterdrücken. Da S. aureus auch an der Entstehung von Lungenentzündungen (Pneumonien) beteiligt ist, nutzen die Forscher Kulturen menschlicher Atemwegsepithelzellen als Modellsysteme. Anhand dieser untersuchen sie, wie das alpha-Toxin auf die Struktur und Funktion der Zellen wirkt, mit dem Ziel, mögliche Angriffspunkte für eine abschwächende Wirkung des Toxins zu finden.
Die jetzt in „Toxins“ publizierten Ergebnisse zeigen, dass ein bestimmter Lipid-Bestandteil der Zelloberfläche, das Sphingomyelin, für den Zusammenbau und damit für die Bildung der alpha-Toxin-Pore essentiell ist. Die Forscher haben dieses Membranlipid mit einem Enzym (einer Sphingomyelinase) chemisch modifiziert und festgestellt, dass sich in den Zellmembranen der anschließend mit alpha-Toxin behandelten Zellen keine Toxin-Poren mehr ausbildeten. Und nachfolgend blieben auch alle sonst üblichen zytotoxischen Wirkungen des alpha-Toxins auf die Atemwegsepithelzellen aus.
Angesichts der global zunehmenden Resistenz vieler Staphylococcus-Stämme gegen Antibiotika (MRSA, Methicillin-resistente Staphylococcus aureus-Stämme) und dem Rückzug vieler Pharma-Konzerne aus der kostenintensiven Antibiotika-Forschung werden alternative Verfahren zur Beherrschung bakterieller Infektionen immer notwendiger. Die Grundlagenforschung aus Greifswald und Münster zeigt einen Ansatz, wie durch vorbeugende Maßnahmen die durch das alpha-Toxin vermittelte pathogene Wirkung von S. aureus verhindert werden kann. [Link zur Publikation]


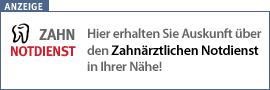
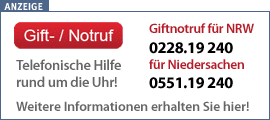
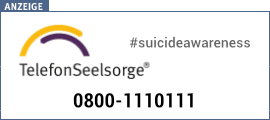



 Der Notfalldienst ist über die kostenfreie Rufnummer:
Der Notfalldienst ist über die kostenfreie Rufnummer:
