
Feb. 27, 2025 | Pressemitteilungen
Bild (v.l.): Prof. Andreas Pascher, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie am UKM, Prof. Alex W. Friedrich, Ärztlicher Direktor des UKM, Ameneh Rekabi, Operationstechnische Assistentin in Ausbildung, Priv.-Doz. Dr. Jens Hölzen, Bereichsleiter Roboterassistierte Chirurgie am UKM, und Nils Wegmann, Operationstechnischer Assistent. (© Foto by UKM/Wibberg)
„Power of the First Name“: Personalisierte Namensschilder
Eine präzise und klare Kommunikation ist während einer Operation entscheidend – sie kann sogar lebensrettend sein. Doch wie behält man im oft hektischen OP-Alltag, in dem alle Personen Mundschutz und OP-Haube tragen, den Überblick über die Teammitglieder und ihre jeweiligen Rollen? Um diesen Herausforderungen zu begegnen, initiierte die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie (ACH) des UKM das Projekt „Power of the First Name“. Inzwischen wurde das Projekt auf sämtliche OP-Bereiche des UKM ausgeweitet.
Münster (ukm/ik) – Kern des Projekts sind personalisierte Namensschilder, die alle OP-Beteiligten gut sichtbar am Kopf tragen. Auf den Schildern sind der Vor- oder Nachname – je nach persönlicher Präferenz – sowie die jeweilige Berufsgruppe angegeben. Ziel ist es, die direkte Ansprache zu erleichtern und so die Teamarbeit sowie die Sicherheit im OP zu fördern. Melanie Damme, Bereichsleiterin des chirurgischen OPs, ist überzeugt: „Durch die Namensschilder kann ich die am chirurgischen Eingriff beteiligten Kolleginnen und Kollegen mit Namen ansprechen, selbst wenn sie durch Bereichsrotationen nur selten hier sind, und die jeweilige Aufgabe des Benannten besser zuordnen. Es ist ein Gewinn für das gesamte Team und für die Patientinnen und Patienten.“
Dass die Idee ausgerechnet in der Roboterassistierten Chirurgie des UKM (Universitätsklinikum Münster) entstanden ist, kommt nicht von ungefähr: „Wir stecken quasi mit dem Kopf in der Konsole fest, nehmen den Raum nicht so richtig gut wahr, und dann ist es enorm wichtig, dass man die Menschen gut ansprechen kann“, erklärt Privatdozent Dr. Jens Hölzen, Bereichsleiter Roboterassistierte Chirurgie am UKM. „Wir haben ein ähnliches Projekt bei unseren Kooperationspartnern in den Niederlanden gesehen, und fanden es so gut, dass wir es einfach übernommen haben.“ Und das zieht Kreise: Nach dem Start in Münster interessieren sich nun auch weitere Kliniken in Deutschland für das Namensprojekt.
Am UKM begegneten einige Beteiligte der Initiative der Chirurgie anfangs mit Unsicherheit und Skepsis. Doch die praktische Umsetzung überzeugte schnell. „Die Namensschilder bringen eine klare Struktur in den OP-Saal und erleichtern die Kommunikation“, sagt Assistenzärztin Charlotte Pollmann. Besonders positiv hebt sie hervor, dass durch die direkte Ansprache Hierarchien abgebaut werden. Denn bewusst wird bei den Namensschildern auf Titel verzichtet. „In anderen Kliniken, wo ich war, gab es dieses Konzept nicht. Es war neu für mich, hat aber sofort reibungslos funktioniert“, so Pollmann. Inzwischen wurde das Konzept auf sämtliche OP-Bereiche im UKM ausgeweitet.
Das Projekt „Power of the First Name“ ist eine der zahlreichen Aktivitäten am UKM, die für die Zertifizierung des UKM als Magnet-Krankenhaus gestartet wurden. Das Magnet-Projekt legt den Fokus auf Themen wie Führungskultur, Zusammenarbeit und Versorgungsqualität und umfasst ganz unterschiedliche Maßnahmen, die letztlich das Ziel haben, das Arbeitsumfeld und einen damit einhergehenden Kulturwandel zu verbessern. Auch Prof. Alex W. Friedrich, Ärztlicher Direktor des UKM, lobt die Initiative: „‚Power of the First Name‘ zeigt, wie einfache, durchdachte Maßnahmen den Klinikalltag nachhaltig verbessern können. Diese Initiative fördert die vertrauensvolle Zusammenarbeit, stärkt die Teamkultur und verbessert damit die Sicherheit der Patientenversorgung im OP.“

Feb. 23, 2025 | Pressemitteilungen
Bild: Kameras und Mikrofone im OP-Saal: Der Eingriff an der Schulter wurde live aus der Raphaelsklinik übertragen. (© Foto by Alexianer)
Münster – Rund 150 Medizinerinnen und Mediziner informierten sich beim diesjährigen „Refixation Update“ an drei Tagen im Mövenpick Hotel über die neuesten Entwicklungen und Techniken auf dem Gebiet der Schulterchirurgie. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Orthopädischen Praxisklinik von Prof. Dr. Jörn Steinbeck, Dr. Kai-Axel Witt und Dr. Malte Holschen sowie der Raphaelsklinik, einem Krankenhaus der Alexianer. Im Fokus der Vorträge standen die Themen Schulterinstabilität, Probleme mit der Rotatorenmanschette, Schulterarthrose und weiteren Gelenkerkrankungen der Schulter.
Expertinnen und Experten aus Deutschland, USA, Spanien, Frankreich und der Schweiz berichteten nicht nur über innovative Operationsverfahren, sondern nahmen bei acht Live-Operationen im OP-Saal der Raphaelsklinik selber das Skalpell in die Hand, um verschiedene arthroskopische und endoprothetische Eingriffe durchzuführen. Die Operationen wurden in den Kongresssaal übertragen, wo sie von den Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmern nicht nur auf der Leinwand verfolgt werden konnten, sondern auch zur Diskussion gestellt wurden. Ihre Fragen wurden in den OP übertragen und von den Operateuren beantwortet. Neben dem Vortrags- und OP-Programm bestand die Möglichkeit, in einem speziell ausgestatteten LKW in Eins-zu-Eins-Betreuung selber Eingriffe an Präparaten vorzunehmen.

Bild: 150 Medizinerinnen und Mediziner verfolgen im Mövenpick die Live-Übertragung aus dem OP der Raphaelsklinik. (© Foto by Alexianer)

Feb. 20, 2025 | Pressemitteilungen
Bild: Dr. Christoph Hoppenheit, Kaufmännischer Direktor des UKM, freut sich zusammen mit Martina Kreimann und Christine Westphal von den Kommunalen Stiftungen Münster über den großen Spendenzuwachs durch die UKM-Mitarbeitenden. (© Foto by UKM/Ibrahim)
Münster (ukm/ae) – Die Restcent-Spende am UKM ist seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken: Zahlreiche Mitarbeitende spenden jeden Monat den Cent-Betrag ihres monatlichen Gehalts für die Mitmachkinder der Stiftung Bürgerwaisenhaus aus Münster. Was zunächst nach einem kleinen Betrag klingt, addiert sich über das Jahr durch die vielen Spenderinnen und Spender zu einer großen Summe. So kamen im vergangenen Jahr insgesamt rund 28.000 Euro zusammen. Neben der Restcent-Spende trugen erstmals auch Einnahmen aus dem Sommerfest und dem Weihnachtsessen der Mitarbeitenden zur Gesamtspendensumme bei, deren Kartenpreis den Mitmachkindern zu Gute kam.
„Wir sind stolz, die Mitmachkinder mit Hilfe unserer Mitarbeitenden bereits seit vielen Jahren unterstützen zu können. Besonders erfreulich ist, dass sich in diesem Jahr erneut viele Beschäftigte für die Restcent-Spende entschieden haben“, betont Dr. Christoph Hoppenheit, Kaufmännischer Direktor des UKM.
Die Stiftung fördert mit ihrer Arbeit Kinder und Jugendliche aus Familien mit hohem Armutsrisiko. Mit Hilfe der Spendengelder können diese individuell unterstützt werden und Bildungs- sowie Freizeitangebote nutzen. Die Heranwachsenden erhalten so die Möglichkeit, beispielsweise ein Instrument zu erlernen oder einer Sportart nachzugehen. Zusätzlich stehen ihnen ehrenamtliche Mitmachpatinnen und -paten zur Seite, die regelmäßig gemeinsame Aktivitäten organisieren. „Mit dem UKM haben wir einen langjährigen, engagierten Partner an unserer Seite. Es ist schön zu erleben, wie die Mitarbeitenden des UKM die Mitmachkinder durch Spenden aber auch durch Einladungen zu spannenden Aktionen unterstützen. Dafür sind wir sehr dankbar.“, sagt Martina Kreimann von den Mitmachkindern der Stiftung Bürgerwaisenhaus.
Auch in diesem Jahr können die UKM-Mitarbeitenden wieder den Betrag der Nachkommastelle auf ihrer Gehaltsabrechnung spenden und damit die Mitmachkinder unterstützen.

Feb. 18, 2025 | Pressemitteilungen
Bild: Das Ergebnis von fast zehn Jahren Forschung konnten Prof. Sonja Ständer (l.) und PD Dr. Claudia Zeidler (r.) gestern in Form des neuen Medikaments in Empfang nehmen. Patientin Ekle Schmalenbach profitiert davon. (© Foto by UKM/Gerbling)
Prurigo nodularis ist eine seltene, besonders quälende juckende Hauterkrankung. Die Knötchen, die am ganzen Körper auftreten können, jucken so immens, dass die Betroffenen sich blutig kratzen – die Lebensqualität wird massiv beeinträchtigt. Bei der Erkrankung spielt ein „Juckreiz-Botenstoff“, das Interleukin 31 eine große Rolle. Nun wird nach neun Jahren Forschung ein entsprechender Antikörper zur Behandlung der Prurigo nodularis und auch der Neurodermitis für den europäischen Markt zugelassen. Wissenschaftliche Studien an der Medizinischen Fakultät der Universität Münster haben maßgeblich bei der klinischen Entwicklung geholfen. Prof. Sonja Ständer, Leiterin des Kompetenzzentrums Chronischer Pruritus (KCP) an der UKM-Hautklinik, krönt damit die Anstrengungen ihrer Forschungen für die betroffenen Patientinnen und Patienten.
Münster (ukm/aw) – Die Erkrankung Prurigo nodularis (PN) hat ursprünglich dazu geführt, dass sich die Wege von Elke Schmalenbach und Prof. Sonja Ständer kreuzten. Die eine, Elke Schmalenbach, als Patientin des Kompetenzzentrums Chronischer Pruritus an der Klinik für Hauterkrankungen am UKM (Universitätsklinikum Münster). Die andere, Prof. Sonja Ständer, als ihre behandelnde Ärztin und Leiterin mehrerer klinischer Studien, auf der Suche nach einer Therapiemöglichkeit für Menschen wie Elke Schmalenbach. „Prurigo nodularis ist eine noch nicht vollständig verstandene Erkrankung, die zunächst in Verbindung mit chronischem Juckreiz, also Pruritus, auftritt. Mit den ersten Symptomen beginnt ein Juck-Kratz-Kreislauf: Kratzen aufgrund des Juckreizes hilft kurzfristig, schädigt jedoch auf Dauer die Haut und führt zu Hautveränderungen in Form von juckenden roten Knötchen. Diese bluten, wenn weiter gekratzt wird. Für die Betroffenen ist das verbunden mit einer deutlich beeinträchtigten Lebensqualität, schlechtem Schlaf und vor allem auch mit Scham bis hin zu sozialem Rückzug“, berichtet Ständer. Jährlich erkranken etwa zwei von 10.000 Menschen neu; Frauen ab dem mittleren Lebensalter sind häufiger betroffen als Männer.
Bei der Münsteranerin Schmalenbach traten erste Symptome schon 2015 auf, mehrere konventionelle Behandlungsversuche der juckenden roten Papeln, die sich bei ihr auf Armen und Beinen ausbreiteten, blieben ohne Erfolg. 2020 endlich führte das inzwischen lebensbestimmende alltägliche Jucken sie in die Pruritus-Ambulanz der UKM-Hautklinik. Die aufgekratzten Hautläsionen erzählten damals von ihrem täglichen Kampf mit der Erkrankung. Sie wird in eine klinische Phase-III-Doppelblind-Studie aufgenommen. Nemolizumab heißt der monoklonale Antikörper, der aus der Neurodermitis-Forschung stammt und der in der Studie auf Wirksamkeit bei PN getestet werden soll. Zunächst landet Schmalenbach aber in dem Studienzweig, bei dem ihr ein Placebo anstatt von Nemolizumab verabreicht wird. „Damit wir die Wirksamkeit neuer Medikamente beweisen können, ist es leider notwendig, Studien doppelblind durchzuführen. Das heißt weder die Behandelnden noch die Behandelten wissen, ob es sich um das zu testende Medikament handelt oder ein Placebo“ sagt Ständer, die neben der Tätigkeit im KCP im Auftrag der Medizinischen Fakultät Münster der Universität Münster forscht.
Doch das Studiendesign sieht vor, dass ein halbes Jahr später auch Schmalenbach die Injektionen mit Nemolizumab erhält. „Was dann passierte, grenzte für mich an ein Wunder“, sagt die 78-jährige Rentnerin. „Die Spritzen haben innerhalb weniger Tage gewirkt und ich konnte kaum glauben, dass ich von jetzt auf gleich den Juckreiz los war“, erinnert sie sich.

Bild: Die Wunden sind abgeheilt: Patientin Elke Schmalenbach (r.) kann nach Jahren des quälenden Juckreizes ihre Schienbeine wieder zeigen. Prof. Sonja Ständer (Mitte) und PD Dr. Claudia Zeidler (l.) haben mit ihrer Forschung maßgeblich dazu beigetragen. (© Foto by UKM/Gerbling)
Seit 2013 hat Ständer zusammen mit Priv.-Doz. Claudia Zeidler im Rahmen von mehreren randomisierten Studien an einer Therapiemöglichkeit für Prurigo nodularis gearbeitet. Dabei haben beide herausgefunden, dass verschiedene Botenstoffe in der Haut, vor allem aber das Interleukin-31, bei den Betroffenen im Überschuss gebildet werden. Nemolizumab blockiert das Interleukin-31. Patientinnen und Patienten wie Elke Schmalenbach wurde im Rahmen der Studien der Antikörper per Injektion einmal im Monat im Studienzentrum der UKM-Hautklinik verabreicht. Nachdem die Injektionstherapie im vergangenen Jahr in den USA erstmals zugelassen wurde, ist das Medikament, das der Pharmahersteller Galderma zur Marktreife geführt hat, seit gestern auch endlich in Europa erhältlich. Vertreter von Galderma lieferten die Injektionen, die die erste Therapiemöglichkeit außerhalb von Studien darstellen, symbolisch an eines ihrer größten und wichtigsten Studienzentren, die UKM-Hautklinik, aus.
Prof. Sonja Ständer und Priv.-Doz. Claudia Zeidler sind stolz, dass sie mit der Marktzulassung von Nemluvio ® schwer betroffenen Patientinnen und Patienten weltweit Hoffnung auf Linderung und damit auch ihre Lebensqualität zurückgeben konnten. Patientinnen wie Elke Schmalenbach danken es ihnen.

Feb. 12, 2025 | Pressemitteilungen
Bild: Iris Noack (Mitte) ist pAVK-Patientin. Zunächst litt sie an dem Gefäßverschluss in den Beinen, später auch an der selteneren Ausprägung in den Armen. Hilfe bekam die 63-jährige Borkenerin in der Angiologie am UKM. Prof. Nasser Malyar (li.) und Dr. Lena Makowski haben sie dort begleitet. (© Foto by UKM/Ibrahim)
pAVK: Wenn den Armen das Blut fehlt
Schmerzen und Missempfindungen in den Armen können ein Zeichen für die „periphere arterielle Verschlusskrankheit“, kurz pAVK, sein, die unter dem Begriff „Schaufensterkrankheit“ vor allem als Problem der Beine bekannt ist. Eher selten – und daher noch relativ unerforscht und in der Breite schlecht versorgt – ist die Symptomatik im Bereich der oberen Extremitäten, wie sie bei der Borkenerin Iris Noack aufgetreten ist. Ihr konnte in der Angiologie der Klinik für Kardiologie I am UKM geholfen werden. Dort hat sich zudem Dr. Lena Makowski im Rahmen einer großen Studie mit den noch vielen offenen Fragen rund um diesen Typ der pAVK befasst.
Münster (ukm/lwi) – Als „Schaufensterkrankheit“ ist die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) schon längst bekannt. Wegen gravierender Gefäßverengungen schmerzen den Betroffenen die Beine mitunter so stark, dass sie – daher der Name – regelmäßig vor beispielsweise Schaufenstern pausieren müssen. Dass die Krankheit in seltenen Fällen auch die oberen Extremitäten betreffen kann, ist hingegen noch weitgehend unerforscht und weniger bekannt. Eine rechtzeitige Diagnose und richtige Versorgung sind aus diesem Grund häufig nicht gegeben – auch, weil die Erkrankung für die Betroffenen (zunächst, und vor allem bei Frauen) asymptomatisch verläuft.
Nur etwa fünfzehn Patientinnen und Patienten werden aktuell jährlich wegen einer pAVK der oberen Extremitäten am UKM behandelt. Eine von ihnen ist Iris Noack, 63 Jahre alt und Altenpflegerin. Erstmalig bemerkte sie vor über 20 Jahren erste Beschwerden in den Beinen, vor etwa zehn Jahren hatte sich die Symptomatik so weit verschlechtert, dass sie Stents bekam, die die Bein-Arterien dauerhaft weiten. Noch im selben Jahr folgten ein Herzinfarkt und dann die ersten Beschwerden in ihrem linken Arm: „Zuerst tat er nur ein bisschen weh, der Schmerz strahlte von der Schulter runter bis in die Finger“, erzählt die Borkenerin. „Dann kamen ein Druckgefühl und Taubheit in den Fingern dazu, die Schmerzen wurden stärker. Irgendwann konnte ich nicht mehr auf dem Arm liegen und auch kein Buch mehr damit halten.“
Dr. Lena Makowski, Mitarbeiterin der „Sektion Angiologie“ innerhalb der „Klinik für Kardiologie I: Koronale Herzkrankheit, Herzinsuffizienz und Angiologie“ am UKM, beschäftigt sich intensiv mit der pAVK der oberen Extremitäten. Im Rahmen einer groß angelegten Studie, über die gerade im renommierten „European Heart Journal“ berichtet wird, versucht Sie, die Diskrepanz in der Diagnostik und Versorgungen von unterer zu oberer pAVK zu ergründen. Makowskis Studie soll helfen, mehr Licht ins Dunkel zu bringen und „hypothesegenerierende Daten“ zu finden, auf deren Basis dann die bestmöglichen Behandlungspfade für die seltene Ausprägung der pAVK gefunden werden können.
Nicht alle erhalten rechtzeitige Hilfe wie Iris Noack. „Betroffene mit pAVK der oberen Extremitäten sind häufig unterversorgt. Das hat auch damit zu tun, dass eine entsprechende Leitlinie für die Behandlung fehlt“, sagt Makowski. Die Folge: Eine höhere Sterblichkeitsrate und häufigere Amputationen. Diese nämlich würden vielerorts viel zu früh erfolgen, sagt Sektionsleiter Prof. Nasser Malyar. „Nicht alle Behandlungszentren verfügen wie das UKM über vielfältige Behandlungsmöglichkeiten oder die Expertise von mehreren notwendigen Fachdisziplinen.“
Soweit ist es bei Iris Noack glücklicherweise nicht gekommen: Bei einem minimalinvasiven Kathetereingriff wurde zunächst versucht, ihre verengte Arterie in der Schulter mit Hilfe eines Ballons zu weiten (dieser ist mit Medikamenten beschichtet, die die Gefäße weiten und offenhalten sollen). Noch im Eingriff hat sich dann aber gezeigt, dass das Aufdehnen allein nicht ausreicht, um den normalen Blutfluss wiederherzustellen, so dass letztlich auch hier ein Stent gesetzt wurde. Weil die Arterienverkalkung im Grunde auf einen Entzündungsprozess zurückzuführen ist, setzen sich diese Stents häufig wieder zu, erläutert Malyar. „Hier ist der Stent aber nach neun Jahren noch offen. Das ist eher selten, aber ein gutes Zeichen, dass er auch weiterhin offen bleibt.“
Iris Noack ist nach ihren Eingriffen inzwischen beschwerdefrei. Das Rauchen hat sie längst aufgegeben, stellt es doch einen Risikofaktor für eine Arteriosklerose, also Ablagerungen in den Arterien, dar. Aber auch entzündlich-rheumatische Erkrankungen der Gefäße, Bluthochdruck, Übergewicht, familiäre Vorbelastungen oder Diabetes sind Risikofaktoren für eine pAVK. „Bei derart Betroffenen sind dann häufig auch weitere Gefäßregionen betroffen und es handelt sich letztlich um Hochrisikopatienten“, sagt Makowski.
Umso wichtiger, dass auch einfache Hinweise auf eine mögliche Erkrankung (der Puls ist an einer Seite des Arms schlechter tastbar, oder der Blutdruck unterscheidet sich bei einer Messung an beiden Armen um mehr als 20 bis 30 mmHG) frühzeitig erkannt und auch weitgehend asymptomatische Patientinnen und Patienten rechtzeitig versorgt werden. Häufig reichen dann Blutverdünner und cholesterinsenkende Medikamente für eine Behandlung aus; und auf einen interventionellen Eingriff kann verzichtet werden.









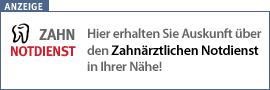
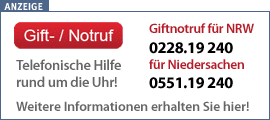
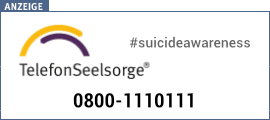



 Der Notfalldienst ist über die kostenfreie Rufnummer:
Der Notfalldienst ist über die kostenfreie Rufnummer: